Der Onlinejournalismus feiert 30. Geburtstag, aber niemand hat Kuchen mitgebracht! Offensichtlich gibt es wenig Grund zu feiern, was den Zustand des Journalismus.online angeht. Einen kleinen Geburtstagsgruß mit ein paar konstruktiven Vorschlägen habe ich im sozialdemokratischen Theorieorgan „Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte“ veröffentlicht, das heute erschienen ist.
In Deutschland war es die Deutsche Welle, die als erste im September 1994 eine redaktionelle Seite ins Netz stellte, auch wenn das Nachrichtenmagazin Der Spiegel bis heute behauptet, Spiegel Online sei im Oktober 1994 die erste journalistische Nachrichtenseite in Deutschland gewesen.
Demokratie in Gefahr
Klingt pathetisch, ist aber so: Eine Demokratie ohne Journalismus ist keine. „Democracy dies in darkness“, schreibt seit 2017 in ihren Zeitungskopf die Washington Post (die ironischerweise dem Amazongründer Jeff Bezos gehört). Was passiert, wenn die Kritikfunktion des Journalismus unterminiert wird, konnten wir live bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen erleben. Autoritäre Regime wie das russische fluten derweil über die Social-Media-Kanäle die Welt mit Desinformation. Wer die Demokratie schützen will, muss dies vor allem auf dem Feld der Medienregulierung tun, denn wir leben in einer Mediengesellschaft.
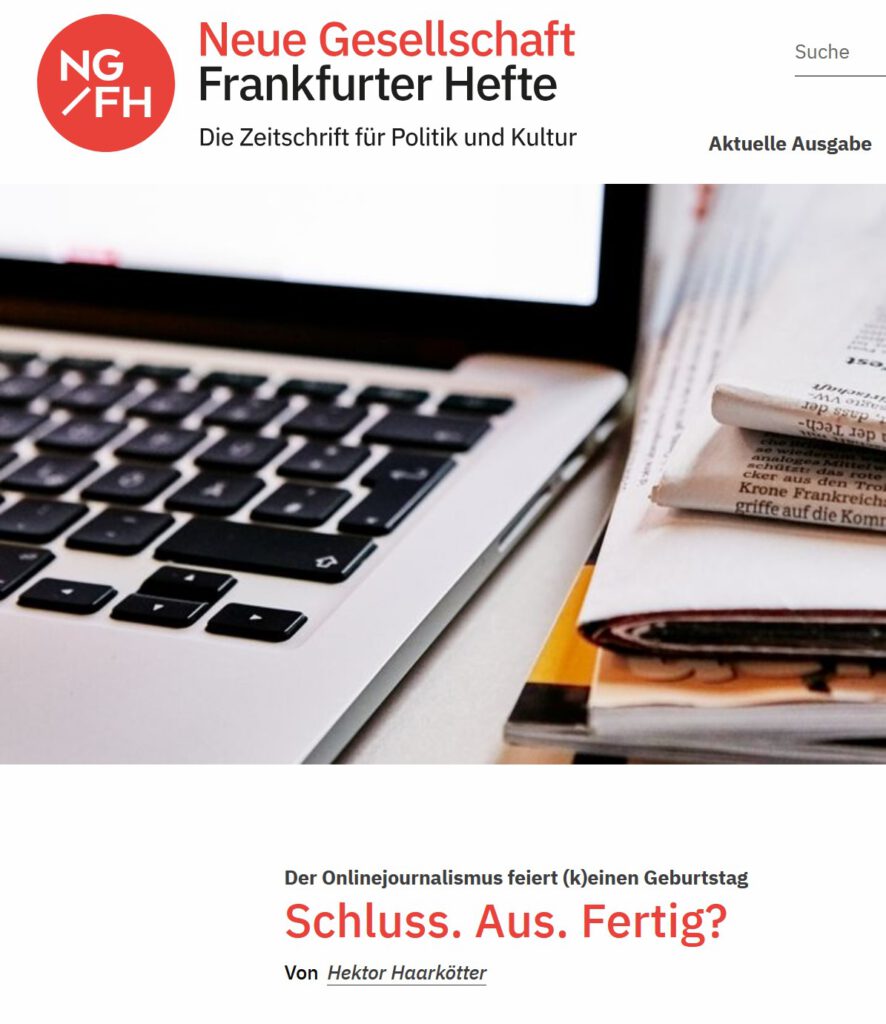
Zu einer effektiven europaweiten und internationalen Medienregulierung gehören zu allererst die Durchsetzung der Interoperabilität aller Systeme und Plattformen (damit nicht einige Anbieter monopolartige Strukturen durchsetzen können), die Transparenz des Internet-Traffic und ein effektiver globaler Datenschutz. Privatwirtschaftlich oktroyierte Nutzerregeln der Plattformbetreiber haben heute zu einer „Privatisierung des Rechts“ geführt. Hier müssen die Möglichkeiten der Judikative genutzt und die Rechte des Einzelnen wieder hergestellt werden.
Nur wundern kann man sich, wie die Politik hierzulande über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk debattiert. Denn dieser Diskurs kennt nur eine Richtung, den der Mittelkürzung und der Programmeinschränkung. Das Gegenteil ist zum Schutz der Demokratie vonnöten. Privatwirtschaftlich organisierte Mediensysteme sind heute schon nicht mehr in der Lage, ihre öffentliche Aufgabe zufriedenstellend zu lösen (siehe USA). In dieser dramatischen Situation ARD & Co. den Betrieb „zeitungsähnlicher Angebote“ im Netz untersagen zu wollen, ist fahrlässig. Über „zeitungsähnliche“ Angebote der Öffentlich-Rechtlichen werden wir nämlich dann froh sein, wenn es keine Zeitungen mehr gibt. Darüber hinaus war schon vor längerem im Gespräch, zusätzlich ein öffentlich-rechtliches Zeitungsangebot zu machen. Diese Diskussion müsste dringend wiederaufleben. Auch der Vorschlag, eine Nachrichtenagentur wie die dpa zu sozialisieren, war schon im Gespräch. Über die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die wesentliche Gesellschafter der dpa sind, ist die Agentur heute schon in Teilen in öffentlichem Besitz. Nur wäre zu überlegen, ob nicht auch deren Nachrichtenangebot, das noch von den Medienhäusern monopolisiert wird, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden könnte, um eine Informationsvielfalt in der Zukunft zu gewährleisten.
Alle gesellschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Maßnahmen, die dem Schutz vor Desinformation dienen, müssen deutlich stärker öffentlich gefördert werden als bisher. Vor allem muss auch im Bildungsbereich noch deutlicher die demokratieerhaltende Funktion des Journalismus unterstrichen und ein Medienkonsum, der auf valide Information setzt, stark gefördert werden. Ansonsten können wir nämlich unter die Geschichte des Journalismus eines jener Akronyme schreiben, die auf den Social Media-Kanälen als Abkürzung so beliebt sind: RIP.
Link zum Aufsatz:
Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte: Schluss. Aus. Fertig? (Haarkötter)

Schreibe einen Kommentar